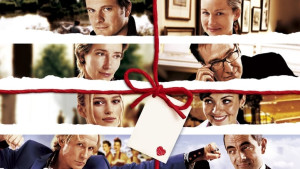Kalla Malla
Mark Lewis arbeitet als »focus puller«, als einer, der an der Kamera die Schärfe einstellt, in einem Londoner Filmstudio. In seiner Freizeit fotografiert er »Pin ups« für Sexmagazine. Doch sein hauptsächliches Interesse gilt einem Dokumentarfilm über die Furcht. Aus diesem Grund ist er zum Mörder geworden. Der Film beginnt mit einem Mord. Mark geht zu einer Prostituierten. Er blickt durch den Sucher seiner Schmalfilmkamera und folgt der Frau in eine Absteige. Die Kamera läuft unterdessen. Die Prostituierte beginnt sich zu entkleiden, der Kamerablick schwenkt auf den Boden. Nicht aus Scham, sondern weil ein Stativbein ausgeklappt wird, an dessen Ende sich ein Stilett befindet. Dann nähert sich die Kamera der nun angstvoll blickenden Prostituierten, für die es, als sie Marks Absichten erkennt, zu spät ist. In ihrem Gesicht bleibt die Todesangst stehen. Im Anschluß filmt Mark das Eintreffen der Polizei und den Abtransport der Leiche. In seinem Haus, dessen unteren Teil er vermietet hat, entwickelt er dann die eben gemachten Aufnahmen und schaut sie sich an. Doch er wird von Helen gestört, die mit ihrer blinden Mutter zur Untermiete bei ihm wohnt und Geburtstag hat. Sie lädt Mark zu ihrer Feier ein. Doch Mark führt ihr als Geburtstagsgeschenk einen Film vor, den sein Vater über ihn gemacht hat. Der war ein Psychiater, der seinen eigenen Sohn als Studienobjekt seiner Forschungen über die extreme Angst mißbrauchte. Helen ist zugleich angewidert und fasziniert. Mark erklärt sich bereit, ihr bei einem Kinderbuch »The Magic Camera« zu helfen. Wenig später begeht und filmt er einen weiteren Mord, an Vivian, die als »Stand In« für einen Star im gleichen Studio arbeitet. Und er kennt auch schon sein nächstes Opfer, eines seiner Modelle. Doch da ist er wegen seines merkwürdigen Verhaltens der Polizei schon verdächtig, und auch Helens blinde Mutter spürt das Verborgene in seiner Existenz. Schließlich entdeckt Helen aus Zufall die wahre Natur Marks. Sie wird dabei von Mark überrascht. Doch der kann sie nicht töten und bereitet, als er die Polizei eintreffen sieht, seinen eigenen Tod vor. Er stürzt sich - voller Angst - in das ausgefahrene Stilett am Stativbein der laufenden Kamera. Dazu tönen von zahlreichen Tonbandgeräten die angstvollen Schreie des jungen Mark, die sein Vater aufgenommen hatte.
Als »Peeping Tom« 1960 in die Kinos kam, verursachte er einen Aufschrei von Kritikern und Publikum, wurde umgehend aus den Kinos entfernt und ruinierte für Jahre die Karrieren von Regisseur Michael Powell und Hauptdarsteller Karlheinz Böhm. Folgendes bekam man damals über den Film zu lesen: »Die einzig wirklich befriedigende Art und Weise, Peeping Tom zu beseitigen, wäre, ihn zusammenzuschaufeln und ihn schnell die nächste Kloake hinunterzuspülen. Selbst dann bliebe noch der Gestank zurück« (Derek Hill, »Tribune«). »Die Bezeichnung für Michael Powells Peeping Tom ist, ganz einfach, widerlich« (Campbell Dixon, »Daily Telegraph«). »Schmutz zu Schauzwecken« (»film-dienst«) - das Echo der zeitgenössischen Kritik war geradezu verheerend.
1977 wird auf dem Filmfestival in Telluride der Regisseur eingeladen, einige seiner Filme vorzustellen. Er bringt »Peeping Tom« mit - und erlebt einen Triumph. 1979/80 kommt der Film abermals in die Kinos - und wird als Meisterwerk gewürdigt. Mehr Horror- denn Kriminalfilm ist »Peeping Tom« vor allem eine Betrachtung über den Voyeurismus, ein Film über das Kino. Powell macht den Zuschauer zum Komplizen seines Protagonisten, läßt ihn dessen Schmerz und Not mitfühlen und hält ihm mit beißender Schärfe und Unausweichlichkeit dann vor, sich zum Komplizen gemacht haben zu lassen. Die Details der Morde, die nicht im Bild gezeigt werden, finden erst in den Köpfen der Zuschauer zusammen - eine subtile Spannungsdramaturgie, wie sie auch Alfred Hitchcock verwandte.
In der Rolle des grausamen Psychiater-Vaters ist Powell selbst zu sehen, den jungen Mark spielt Powells eigener Sohn, heute Maler. »Ich fühlte mich dem Helden sehr nahe, der ein absoluten Regisseur ist, einer, der sich dem Leben nähert wie ein Regisseur, der sich dessen bewußt ist und darunter leidet. Er ist ein Techniker der Emotion. Und ich bin einer, der von Technik begeistert ist und immer im Geiste die Szene montiert, die sich vor mir auf der Straße abspielt, so konnte ich seine Angst teilen« (Michael Powell).
Wenn man »Peeping Tom« heute sieht und im Kopf behält, was das damalige Publikum gewöhnt war, fällt es nicht schwer, diese Reaktion nachzuvollziehen, auch wenn sie zum Verschwinden eines Klassikers geführt hat, der erst in den 80ern von Martin Scorsese vereinnahmt und zur Wiederaufführung gebracht wurde. Heute gilt »Peeping Tom« als Sternstunde des britischen Films - er ist ebenso cineastisches Kunstwerk wie verstörender Thriller. »Peeping Tom« wird häufig mit Hitchcock's »Psycho« (1960) verglichen. Beide sind fast zur selben Zeit entstanden und erzählen von Serienmördern, die das Publikum durch geschickte Manipulation als Identifikationsfiguren akzeptieren muss. Doch während Hitchcock sein Publikum den Schrecken lustvoll und augenzwinkernd genießen lässt, ist Powells Film das düstere Psychogramm einer zerstörten Seele.
»Peeping Tom« verweigert sich der klassischen Dramaturgie, einen Helden zu erzählen, der den Mörder jagt. Stattdessen ist der Mörder selbst Zentrum des Films, von Beginn an. Damit nimmt er viel später entstandene Serienkiller-Filme wie »Henry« (1986) vorweg. Dass ausgerechnet Filmliebling Karlheinz Böhm diesen Killer spielt (und das macht er großartig intensiv), war ebenso ein Schock wie Michael Powells ungeschminkte Darstellung einer heuchlerischen Gesellschaft, in der nette ältere Herren im Zeitungsladen Pornobildchen unterm Ladentisch kaufen. War bei Hitchcocks Norman Bates eine gestörte Mutter/Sohn-Beziehung Grundlage für die mörderischen Tätigkeiten, ist hier eine noch mehr gestörte Vater/Sohn-Beziehung die Ursache. Marks Vater hat seinen Sohn für Studien zur Angst missbraucht. Gespielt wird der dämonische Vater von Regisseur Michael Powell persönlich, wir sehen ihn in Quasi-Dokumentaraufnahmen im Film. Die letzte Dialogzeile des Films ist Marks Kinderstimme aus dem Off: »Gute Nacht, Vater. Halt' meine Hand...«
Zusammen mit der brillanten Filmmusik von Brian Easdale, der lediglich ein Klavier zur Untermalung benutzt (was sehr oft einen Stummfilm-Effekt erzielt) und den genialen Bildern von Kameramann Otto Heller schafft Powell eine Atmosphäre der konstanten Beunruhigung. In Marks Vorführraum wirkt Anna Massey wie in Blut getaucht. Die Einführungs-Sequenz (den ersten Mord) sehen wir aus Marks Sicht, durch das Objektiv seiner Kamera, danach betrachtet Mark seine Tat als Film im Vorführraum - Jahre bevor das Wort »Snuff« überhaupt erfunden wurde. Karlheinz Böhm sagte später selbst, er habe nur zwei wichtige Filme in seinem Leben gemacht - der eine ist Fassbinders »Martha« (Fassbinder entdeckte Böhm in den 70ern neu), der andere ist »Peeping Tom«.
Fazit: Für die damalige Zeit ein sehr aufwühlender und kontroverser Film. Der Film fesselt durch seine düstere Atmosphäre und die für die damalige Zeit durchaus unkonventionelle Handlung. Schade, daß man seine Qualitäten erst so spät entdeckt hat. Einigen Quellen zufolge soll es eine ursprüngliche 109-Minuten-Fassung gegeben haben, die allerdings weltweit nicht mehr erhältlich sein soll. Inwieweit dies der Wahrheit entspricht, ist nicht mehr nachzuvollziehen.